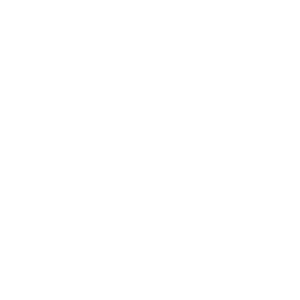Aspirin, Antibiotika, Anti-Baby-Pille, Blutdrucksenker, Antidepressiva: Diese und viele andere gängige Medikamente können als Nebenwirkung Ohrgeräusche auslösen – oder einen bestehenden Tinnitus verstärken. Wir erklären Ihnen, welche Medikamente bedenklich sind und was Sie tun können – zur Ursachenforschung und zur Vorbeugung.
Exklusiv bei uns finden Sie eine Liste sämtlicher Wirkstoffe, die Tinnitus auslösen können, samt der bekannten Handelsnamen. Und Sie erhalten Antworten auf diese Fragen:
- Warum lösen manche Arzneimittel Ohrgeräusche aus?
- Kommt das Ohrgeräusch wirklich von der Arznei?
- Soll ich das Medikament absetzen? Oder kann ich es weiter einnehmen? Was muss ich beachten?
- Klingt der Tinnitus wieder ab?
Eines vorweg: Zum Glück klingt das seltsame Ohrgeräusch – meist ein Rauschen, Pfeifen, Sausen, Piepen oder Brummen – tatsächlich in der Regel nach einigen Stunden, Tagen oder Wochen wieder ab.
Mit bewährten Selbsthilfe-Maßnahmen wie einer gezielten Ablenkung und Entspannung können Sie dem nachhelfen.
Aber auch wenn ein Tinnitus länger bestehen bleibt, lässt er sich heute gut behandeln. Auf keinen Fall muss das Ohrgeräusch ein dauerhaftes Problem darstellen, das das Leben trübt.
Tinnitus als Nebenwirkung von Medikamenten
Seit Langem ist bekannt, dass eine Vielzahl von Arzneien Tinnitus auslösen können. Wenn das geschieht, dann immer aus dem gleichen Grund: Das Medikament verursacht – in einigen Fällen – Hörstörungen, die sich dann durch bestimmte Ausgleichs- und Rückkopplungsvorgänge im Hörsystem zu einem Tinnitus „aufschaukeln“.

Im Hörzentrum des Gehirns („auditiver Kortex“), wo das bewusste Hören stattfindet, geraten dabei einige Nervenzellen in eine unkontrollierte Überaktivität. Das nehmen Sie dann als „Ohrgeräusch“ wahr.
Zu Hörstörungen kommt es, wenn ein Medikament die Funktion des Innenohrs stört. Dort liegt unser eigentliches Hörsinnesorgan: die Hörschnecke mit ihren hochempfindlichen Härchenzellen. Wenn diese Zellen geschädigt werden oder sich die Biochemie innerhalb der Hörschnecke verändert, kann das leicht einen Tinnitus auslösen.
Ein Medikament kann aber auch die „Signalübertragung“ über den Hörnerv oder den Hirnstoffwechsel im Hörsystem beeinträchtigen. Wird die Verarbeitung der Hörimpulse in den diversen „Schaltknoten“ oder im Hörzentrum gestört, kann auch dies zu einem Tinnitus führen.
Möglicherweise erhöhen einige Medikamente – ebenso wie diverse Drogen – auch die Empfindlichkeit im Hörsystem, was es dann umso wahrscheinlicher macht, dass ein Tinnitus entsteht.
Um diese Medikamente geht es
Wirkstoffe, von denen bekannt ist, dass sie Hörstörungen oder Hörverlust und damit Tinnitus verursachen können, bezeichnet man als „ototoxisch“ (wörtlich: „giftig für das Ohr“).
Vor allem einige Vertreter der folgenden Medikamentengruppen können Ohrgeräusche auslösen oder verstärken:
- Schmerzmittel wie Aspirin (ASS) und Ibuprofen sowie zahlreiche andere schmerzlindernde, entzündungshemmende und fiebersenkende Arzneimittel
- Antibiotika: diverse gängige Arzneien gegen bakterielle Infektionen z.B. des Hals-Nasen-Ohrenbereichs, der Atemwege und der Harnwege
- Verhütungsmittel (Anti-Baby-Pille) und andere Hormon-Präparate
- Herz-Kreislauf-Medikamente: zahlreiche viel genutzte Arzneien gegen Bluthochdruck, Herzschwäche, Herzrhymusstörungen usw.
- Entwässernde Medikamente (Diuretika)
- Trizyklische Antidepressiva: Gängige klassische Medikamente bei Depressionen, Angst- und Panikstörungen
- SSRI-Antidepressiva (Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer): eine neuere Wirstoffgruppe
- Angstlösende Medikamente (Anxiolytika)
- Benzodiazepine: schnell süchtig machende „Tranquilizer“, bei denen vor allem der Entzug häufig Tinnitus verursacht
- Schlafmittel
- Potenzmittel wie Viagra
- Medikamente gegen Pilz- und Virusinfektionen
- Krebsmedikamente wie Chemotherapeutika
Weiter unten finden Sie eine ausführliche Liste der konkreten Wirkstoffe samt der Handelsnamen der Medikamente. Zuvor aber noch einige wichtige Hinweise und Ratschläge.
Tinnitus-Risiko bei jeder vierten Arznei
Wenn Sie wegen eines Ohrgeräusches zum Hausarzt oder HNO-Arzt gehen, klärt ein guter Arzt immer Ihre aktuelle Medikamentierung ab. Erst Recht, wenn typische augenfällige Tinnitus-Auslöser wie ein Knalltrauma, eine Verstopfung des Ohrs oder eine Mittelohrentzündung nicht ersichtlich sind.
Denn Tinnitus durch Medikamente ist häufiger, als gemeinhin angenommen wird. Immerhin mehrere hundert Arzneimittel führen Tinnitus als unerwünschte Nebenwirkung auf.
In der Side Effect Resource Database (SIDER 4.1) werden aktuell 1430 gebräuchliche Arzneien mit insgesamt 5886 verschiedenen Nebenwirkungen gelistet.
395 dieser 1430 Arzneien – also 27,6 Prozent – geben Tinnitus (oder Synonyme wie „Ohrensausen“ oder „Ohrgeräusche“) als gemeldete Nebenwirkung an. Hier können Sie die lange Liste selbst einsehen.

Zwar ist das Tinnitus-Risiko bezogen auf den einzelnen Anwendungsfall bei den meisten dieser Arzneien relativ gering. Hochgerechnet gehen aber wahrscheinlich allein im deutschsprachigen Raum jedes Jahr zigtausende Tinnitus-Fälle auf Medikamente zurück.
Das Risiko einer Tinnitus-Verursachung durch Arzneimittel sollte daher nicht heruntergespielt, sondern unbedingt ernstgenommen werden.
Das gilt insbesondere für die behandelnden Ärzte. Und gerade bei solchen Patienten, die ohnehin deutlich anfälliger für Ohrgeräusche sind, etwa aufgrund einer bestehenden Hörschwäche, Geräuschüberempfindlichkeit, akuten Erkrankung im Hals-Nasen-Ohren-Bereich, HWS-/Kieferstörung, Depression oder Angststörung.
Verstärkung von Ohrgeräuschen
Das Wissen um hörschädigende Arzneimittel ist nicht nur für die Ursachenforschung wichtig, sondern auch zur Vorbeugung bei denen, die schon länger einen Tinnitus haben. Denn:
Ototoxische Medikamente können nicht nur neue Ohrgeräusche auslösen, sondern auch einen bestehenden Tinnitus verstärken.
Der Tinnitus wird dann etwa – zumindest vorübergehend – lauter, sodass man ihn als störender und belastender empfindet. Nicht selten wird auf diese Weise ein bereits gut „habituiertes“ (das heißt unwichtig gewordenes und meist überhörtes) Ohrgeräusch wieder zu einem größeren Leiden.
Tinnitus nach Medikamenten-Einnahme: Was tun?
Wenn Sie im zeitlichen Zusammenhang mit der Tinnitus-Entstehung (bzw. -Verstärkung) Medikamente eingenommen haben, prüfen Sie bitte als Erstes die Packungsbeilage.
Der Beipackzettel ototoxischer Medikamente weist in der Regel ausdrücklich darauf hin, dass Tinnitus / Ohrgeräusche / Ohrensauen, Gehörverlust oder Schwindel als unerwünschte Nebenwirkungen auftreten können.

Schwindel und Hörstörungen sind dabei regelmäßig zwei Seiten der gleichen Medaille. Denn das Gleichgewichtsorgan liegt ebenfalls im Innenohr, unmittelbar neben der Hörschnecke. Zudem teilen sich beide Organe den gleichen Hirnnerv.
Häufig führend entsprechende Medikamente auch noch diverse andere Wahrnehmungs-, Empfindungs- oder Bewusstseinsstörungen als bekannte Nebenwirkungen auf, zum Beispiel Sehstörungen.
Soll ich das Medikament absetzen?
Grundsätzlich nein. Dies muss aber in jedem Einzelfall abgewogen werden und obliegt allein Ihrer Verantwortung bzw. der Ihres Arztes.
Bedenken Sie bitte: Nur weil ein Medikament Tinnitus als mögliche Nebenwirkung ausweist, heißt das noch lange nicht, dass das Ohrgeräusch bei Ihnen tatsächlich durch das Medikament verursacht wurde.
Wenn aber anhand der Packungsbeilage dieser Verdacht besteht, besprechen Sie das Vorgehen umgehend mit dem Arzt, der Ihnen das Medikament verschrieben hat, ggf. auch mit Ihrem HNO-Arzt. Zu klären ist:
- Gibt es ein alternatives Medikament mit vergleichbarer Wirkung, das in punkto Hörschäden bzw. Tinnitus unbedenklich ist?
- Wenn nicht, kann die Dosis des Medikaments verringert werden?
- Gibt es alternative Behandlungsmöglichkeiten gegen die betreffenden Beschwerden?
- Welche Folgen hätte ein Absetzen des Medikaments für Sie? Müsste es ausgeschlichen (statt abrupt abgesetzt) werden?
- Überwiegt der Nutzen des Medikaments das Risiko bleibender Hörschäden oder Ohrgeräusche?
Ein Absetzen ototoxischer Arzneien kann das Fortschreiten von Tinnitus und Hörverlust verhindern und den Tinnitus zum Abklingen bringen. Falls Sie das „verdächtige“ Medikament nach Einschätzung Ihres Arztes bedenkenlos absetzen oder austauschen können, sollten Sie das auch tun.
Setzen Sie das Medikament aber bitte nicht leichtfertig ab, wenn Ihnen dadurch gesundheitliche Schäden drohen.
Letztlich gilt es, individuell abzuwägen: Bei lebenswichtigen Medikamenten, etwa bei Herzschwäche oder in der Krebstherapie, überwiegt der Nutzen vermutlich bei weitem die Risiken und Nebenwirkungen.

Dagegen sollte man bei der Behandlung von leichten Schmerzen oder Infektionen, aber auch bei Depressionen und Angstzuständen unbedingt mit dem Arzt über alternative Behandlungsmöglichkeiten sprechen.
Bei nicht rezeptpflichtigen Medikamenten können Sie auch in Ihrer Apotheke nach Alternativen fragen.
Kommt der Tinnitus wirklich vom Medikament?
Mit absoluter Gewissheit ist das in der Praxis nur selten zu beantworten. Der Tinnitus kann vom Medikament verursacht worden sein. Es kann sich aber auch um eine Koinzidenz – also ein zufälliges zeitliches Zusammenfallen – handeln.
Dass das Medikament den Tinnitus verursacht hat, ist umso wahrscheinlicher,
- je häufiger „Tinnitus“, „Hörschäden“ o.Ä. bei dem konkreten Medikament als Nebenwirkung auftreten
- je höher das Medikament dosiert wurde
- je länger bzw. regelmäßiger es verabreicht wurde
- je unmittelbarer nach der Medikamenten-Einnahme der Tinnitus aufkam
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist das Medikament verantwortlich, wenn Ihnen kurzfristig nach der Einnahme eine spürbare Hörminderung auffiel. Auch das Aufkommen eines medikamentenbedingten Tinnitus erfolgt in der Regel kurzfristig, bei Tabletten etwa innerhalb von 15 Minuten bis wenige Stunden nach der Einnahme.
Gerade bei erhöhtem Tinnitus-Risiko, schon vorhandenen Hörschäden und/oder stark ototoxischen Arzneien empfehlen sich wiederholte Hörtests („Audiometrie“) vor, während und nach der Behandlung beim HNO-Arzt.
Zu beachten ist aber:
Es bedarf keiner anhaltenden Hörschädigung, um einen Tinnitus auszulösen. Es genügen mitunter kurzfristige, vorübergehende Hörstörungen, die sich nicht in einer spür- oder messbaren Hörminderung äußern.

Ein Tinnitus kann daher durch ein Medikament ausgelöst werden, ohne dass man eine bewusste Veränderung oder Verschlechterung des Hörens bemerkt hat.
Unter Umständen verursacht ein ototoxisches Medikamente auch erst dann ein Ohrgeräusch, wenn noch weitere typische Tinnitus-Auslöser hinzukommen, zum Beispiel Lärm, Schwerhörigkeit, eine Mittelohrentzündung, eine Störung von Halswirbelsäule oder Kiefer, Stress, Geräuschempfindlichkeit oder große Stille.
Falls der konkrete Verdacht besteht, dass solche oder andere Faktoren an der Tinnitus-Entstehung beteiligt waren, sollte dies unbedingt zügig ärztlich abgeklärt und – wenn möglich – gut behandelt werden.
Klingt der Tinnitus wieder ab?
Ein medikamentenbedingter Tinnitus hält – in der Regel – nur solange an, wie Sie das Medikament einnehmen. Mit dem Absetzen klingt der Tinnitus meist wieder ab – jedenfalls wenn sich dann auch die Hörschädigung zurückbildet.
Allerdings: Verlassen kann man sich darauf nicht. Schon gar nicht bei Arzneien wie Aminoglykosid-Antibiotika, die durchaus einen dauerhaften Hörverlust bewirken können.
Wenn ein Tinnitus nach dem Absetzen zunächst bestehen bleibt, kann das mehrere Gründe haben:
- Das Medikament hat den Tinnitus gar nicht verursacht.
- Eine vom Medikament verursachte Hörschädigung dauert noch an.
- Der Tinnitus hat sich schon verselbständigt.
Grundsätzlich gilt: Ein Tinnitus kann schon nach relativ kurzer Zeit ganz „autonom“ fortbestehen, völlig unabhängig davon, ob der ursprüngliche Auslöser andauert.
Eine ganz zentrale Erkenntnis aus der neurophysiologischen Tinnitus-Forschung ist: Ist der Tinnitus erst einmal ausgelöst, wird er im Wesentlichen durch „Rückkopplungen“ aufrechterhalten und verstetigt, die sich vor allem aus der Stressreaktion auf das Geräusch und der Aufmerksamkeit dafür speisen.
Daraus folgt, dass der richtige Umgang mit dem Tinnitus – von einer guten Aufklärung bis zu einer systematischen Ablenkung und Entspannung – ganz entscheidend für den weiteren Verlauf ist. Und zwar von Beginn an.
Systematisch genesen
Falls das Ohrgeräusch nach dem Absetzen des Medikaments nicht abklingt und Sie Ihre Genesung ganz systematisch angehen wollen, legen wir Ihnen Das Große Tinnitus-Heilbuch ans Herz.

Auf dem aktuellen Stand von Forschung und Therapie bündelt dieser Ratgeber die erwiesenermaßen wirksamsten Heilungsstrategien zu einem äußerst effektiven Selbsthilfe-Programm.
Wie häufig ist Tinnitus als Nebenwirkung?
Beachten Sie bitte, dass das Tinnitus-Risiko bei den unten aufgeführten Medikamenten sehr unterschiedlich ist.
Anhand der „offiziell“ gemeldeten Fälle wird in folgenden Stufen angegeben, wie häufig Tinnitus nach derzeitigem Kenntnisstand als unerwünschte Wirkung auftreten kann:
- Sehr häufig: bei mehr als 1 von 10 Behandelten (>10%)
- Häufig: bei bis zu 1 von 10 Behandelten (10%)
- Gelegentlich: bei bis zu 1 von 100 Behandelten (1%)
- Selten: bei bis zu 1 von 1.000 Behandelten (0,1%)
- Sehr selten: bei bis zu 1 von 10.000 Behandelten (0,01%)
Das Schmerzmittel Ibuprofen zum Beispiel führt Tinnitus lediglich als „seltene“ Nebenwirkung auf, die „nur“ bei (bis zu) einem von 1.000 Behandelten auftritt. Auch wenn unser Vertrauen in die Zuverlässigkeit solcher Angaben begrenzt ist, so ist doch klar:
Ibuprofen kann Ohrgeräusche auslösen. Dass dies passiert, ist aber relativ unwahrscheinlich. Bei einer häufigen Anwendung, höherer Dosierung oder Langzeitanwendung ist allerdings mit einem deutlich erhöhten Risiko zu rechnen.
Das Risiko in Bezug auf den einzelnen Anwendungsfall sollte grundsätzlich auf keinen Fall überschätzt bzw. übertrieben werden. Es sollte allerdings – insbesondere von Ärzten – auch nicht bagatellisiert werden.

Wenn etwa ein massenhaft genutztes „Volksmedikament“ wie Ibuprofen bei einer Million Behandlungen immerhin bis zu tausend Tinnitus-Fälle verursacht, so ist diese vermeintlich „seltene“ Nebenwirkung eben keine Seltenheit.
Welche Medikamente verursachen Tinnitus?
Im folgenden führen wir – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – Wirkstoffe auf, von denen bekannt ist, dass sie „ototoxisch“ sind, also das Gehör schädigen bzw. stören und Tinnitus auslösen können.
Bitte beachten Sie, dass sich Handelsnamen der Medikamente häufig von den Wirkstoffen unterscheiden. Abweichende Handelsnahmen haben wir – ebenfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit – in Klammern angefügt.
Azetylsalizylsäure (ASS, Aspirin, Grippostad, Togal u.a.)
Prominentester Wirkstoff unserer Liste ist Azetylsalizylsäure (ASS), weltweit bekannt unter dem Markennamen Aspirin.
Wenn Forscher in Laborversuchen Mäusen einen Tinnitus verpassen wollen, dann klappt das äußerst zuverlässig mit einer Kombination aus großem Lärm und hohen Dosen von Aspirin! Beides zusammen bewirkt derart starke Hörstörungen, dass die meisten Nager dann ein Ohrgeräusch entwickeln.
Kaum ein anderer Wirkstoff ist so populär wie das schmerzlindernde, fiebersenkende, entzündungshemmende, Blutgerinseln vorbeugende ASS.
Gerade bei Überdosierung oder lange andauernder Anwendung können aber Ohrgeräusche oder andere zentralnervöse Störungen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Sehstörungen oder Benommenheit auftreten.
Als potenziell hörschädigend galt ASS lange Zeit erst ab einer sehr hohen Tagesdosis von 1 bis 3 Gramm. Das ist mehr als das Zehnfache dessen, was z.B. zur Vorbeugung vor Herzinfarkten empfohlen wird. Zudem wurde von Ärzten immer wieder behauptet, dass gewöhnliche Anwendungsmengen von Aspirin unbedenklich seien und nicht zu einem anhaltenden Tinnitus führen.
Eine große US-amerikanische Studie kam jedoch Anfang 2022 zu dem Ergebnis, dass schon wiederholte mäßige Dosen von ASS das Risiko eines anhaltenden, chronischen Tinnitus deutlich erhöhen.
Andere Schmerzmittel und Entzündungshemmer
Auch viele andere Schmerzmittel können Tinnitus verursachen, insbesondere die sogenannten „nicht-steroidalen Antirheumatika“ (NSAR) bzw. „Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs“ (NSAID), zu denen auch Ibuprofen gehört.
Ibuprofen (Ibusan, IbuHexal, Ibuflam, Ibu-Lysin, Dolormin, Nurofen, Spalt, Grippal): Weit verbreiteter Wirkstoff zur Behandlung von leichten bis mäßigen Schmerzen, Entzündungen und Fieber
Indometacin (Indobene): hauptsächlich zur Therapie rheumatischer Erkrankungen eingesetzt, aber auch bei Schmerzen, Schwellungen, Entzündungen und Fieber anderer Ursache.
Naproxen (Dolormin, Naprostad): schmerzlindernd, fiebersenkend und entzündungshemmend, kommt besonders in der Behandlung von Entzündungen der Gelenke (Arthritis), Gicht und Gelenkverschleiß (Arthrose) sowie bei krampfartigen Beschwerden während der Regelblutung zum Einsatz.
Piroxicam: wirkt entzündungshemmend, schmerzstillend und fiebersenkend zugleich. Zudem hat er ausgeprägte antirheumatische Eigenschaften.
Celecoxib: Antirheumatikum, das vor allem bei Gelenkbeschwerden wie Arthritis eingesetzt wird. Wirkt gegen Schmerzen, Entzündung und Fieber.
Buprenorphin (Buprendo, Buprenorphin AWD, Buvidal, Norspan, Suboxone, Subutex, Temgesic, Transtec): Opioid, das bei starken akuten und chronischen Schmerzen sowie in der Substitutionstherapie bei Opioidabhändigkeit eingesetzt wird.
Meloxicam: Antirheumatikum, das entzündungshemmend, schmerzstillend und fiebersenkend wirkt
Articain (Ultracain, Orabloc): Lokalanästhetikum, das vor allem in der Zahnmedizin verwendet wird
Lidocain (Actilogic, Ambene, Dentinox, Dynexan, Emulus, Fortacin, Gelicain, Heweneural, Instillagel, Jelliproct, Lemocin, Licain, Lidoject, Lidotec, Parodontal, Rapydan, Locastad, Supertendin, Trachillid, WICK Sulagil, Xylocain, Xylocitin, Xyloneural, Xylonor, Doloproct, Emla, Lemocin, Versatis u.a.): weit verbreitetes, örtlich wirksames Betäubungsmittel (Lokalanästhetikum), eingesetzt bei Operationen, in der zahnärztlichen Behandlung sowie bei einer Vielzahl von Beschwerden (z.B. Halsschmerzen).
Frovatriptan (Allegro, Frovalan): Serotonin-Rezeptor-Agonist bei Migräne
Almotriptan (Almogran, Dolortriptan): zur Behandlung akuter Migräne-Attacken.
Eletriptan (Relpax): zur Akutbehandlung von Migräne
Dexketoprofen (Sympal): Schmerzmittel u.a. bei Rücken- und Gelenkschmerzen, Menstruationsbeschwerden oder Zahnschmerzen.
Etoricoxib (Arcoxia, Etori, Etoriax, Etorican, Etoricox, Exiner, Tauxib): Antirheumatikum zur Behandlung von Arthrose, Arthritis und Gicht
Antibiotika
Bei vielen gebräuchlichen Antibiotika kann bereits die empfohlene Dosis für Gehör stören oder schädigen und so einen Tinnitus hervorrufen.
Gerade bei Infektionen im Hals-Nasen-Ohren-Bereich (z.B. Mittelohrentzündung), die ja ebenfalls mit einem erhöhten Tinnitus-Risiko einhergehen, sollte der Gebrauch dieser Arzneien daher gut abgewogen werden.
Ciprofloxacin (Cipro, Ciprobay, Ciprobeta, CiproHexal, Ciloxan): Weit verbreitetes Antibiotikum u.a. bei Darm-, Gallenwegs-, Harnwegs-, Bauchhöhleninfektionen; auch bei lokalen Augen- oder Ohreninfektionen als Tropfen.
Cefpodoxim: eingesetzt bei Infektionen im Hals-Nasen-Ohren-Bereich (z.B. Mandelentzündung, Nasennebenhöhlenentzündung), der Atemwege (z.B. Bronchitis) und der Harnwege (z.B. Blasenentzündung)
Erythromycin (Erythrocin, Infectomycin): angewandt bei Nasennebenhöhlenentzündung, Mittelohrentzündung, Lungenentzündung, Keuchhusten, Harnwegsinfektionen, Diphterie sowie Infektionen von Haut und Magen-Darm-Trakt. Beliebtes Ersatzmittel bei Penicillin-Allergie.
Moxifloxacin (Avalox, Vigamox): eingesetzt vor allem bei Nasennebenhöhlenentzündung (Sunusitis, chronischer Bronchitis und Lungenentzündung.
Roxithromycin (Roxi, RoxiHexal, Roxithro-Lich, Rulid): Breitbandantibiotikum, vor allem bei Infektionen im Hals-Nasen-Ohrenbereich, der Atemwege, der Harnwege und der Haut
Amikacin (Amikin): Ein per Infusion verabreichtes Aminoglykosid-Antibiotikum mit relativ hoher Ototoxizität
Cefepim: Breitbandantibiotikum u.a. bei Atemwegsinfektionen wie Lungenentzündung und Harnwegsinfektionen
Ofloxacin (Floxal, Oflox, Ofloxa-Vision): Antibiotikum u.a. für Entzündungen im Hals-Nasen-Ohren-Bereich, der Atemwege, des Magen-Darm-Traktes, der Geschlechtsorgane, Niere, Harnwege und der Haut
Teicoplanin (Targocid): Antibiotikum gegen diverse Arten von Entzündungen, das meist in Form von Infusionen verabreicht wird.
Ethambutol (Myambutol, EMB-Fatol) / Isoniazid (Isozid): Hochspezialisierte Antibiotika gegen Tuberkulose
Norfloxacin (Bactracid, Barazan, Chibroxin, Firin, Floxacin, Norfluxx, Noroxin, Zoroxin u.a.): Breitband-Antibiotikum gegen Infektionen der Harnwege und Geschlechtsorgane
Tobramycin (Bramitob, Gernebcin, Tob, Tobradex, Tobramaxin, Tobrazid, Vantobra, Tobi): Breitspektrum-Antibiotikum für eine Vielzahl von Infektionen, z.B. der Lunge, des Herzens oder der Augen
Linezolid (Zyvoxid): Neuartiges Antibiotikum für die klinische Anwendung
Verhütungsmittel („Anti-Baby-Pille“)
Ethinylestradiol (Lovelle, Belara, Desmin, Trisiston, Neo-Eunomin, Gravistat, Cileste, NovaStep, Pramino, Yasmin, Ovysmen, aida, Microgynon, Trigoa, Conceplan u.v.a.): Derivat des weiblichen Sexualhormons Estradiol, sehr häufiger Bestandteil der oralen Empfängnisverhütung („Pille“) sowie in Verhütungspflastern und Verhütungsringen.
Chlormadinon[acetat] (Amelina, Angiletta, Belara, Bellissima, Bonita, Chariva, Chloee, Enriqua, Lilia, Lisette, Madinance, Madinette, Minette, Mona Hexal, Neo-Eunomin, Pink Luna, Solera u.a.): künstlich hergestelltes Sexualhormon, das zur Empfängnisverhütung, in der Hormonersatztherapie in den Wechseljahren, bei Kinderwunsch sowie bei schwerer Akne eingesetzt wird.
Antidepressiva
Trizyklische Antidepressiva
Die erste Generation von Antidepressiva wird immer noch flächendeckend zur Behandlung von psychischen Erkrankungen eingesetzt, neben Depressionen auch bei Angstzuständen, Schmerzsyndromen und Phobien.
Amitriptylin (Amineurin, Amioxid, Syneudon): einer der bekanntesten Wirkstoffe gegen Depressionen und chronische Schmerzen, gehört zu den trizyklischen Antidepressiva und damit zur ersten Generation von antidepressiven Wirkstoffen. Er wirkt stimmungsaufhellend, angstlösend und beruhigend. Des Weiteren lindert Amitriptylin die Schmerzintensität bei Nervenschmerzen.
Trimipramin (Stangyl, Trimineurin): stimmungsaufhellendes, angstlösendes, beruhigendes und schlafförderndes Antidepressivum. Vor allem bei Depressionen eingesetzt, die mit Unruhe, Angst und Schlafstörungen einhergehen.
Clomipramin (Anafranil): Derivat von Imipramin, das insbesondere bei Zwangsstörungen sowie bei Angsterkrankungen, Depressionen und chronischen Schmerzen eingesetzt wird.
Imipramin: ursprünglich das allererste gebräuchliche Antidepressivum, eingesetzt vor allem zur Behandlung von Depressionen, Angst- und Panikstörungen und sozialen Phobien.
Tetrazyklische Antidepressiva
Maprotilin: zur Behandlung von Depressionen und Angststörungen, gerade wenn diese mit Schlafstörungen verbunden sind.
SSRI (Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer)
Auch Vertreter dieser neueren Generation von Antidepressiva lösen unter Umständen Ohrgeräusche aus.
Citalopram (Cipramil, Citalon): Beliebtes Antidepressivum zur Behandlung von Depressionen, Angst- und Panikstörungen, Manie und bipolarer Störung.
Paroxetin (Paroxat, Paroxedura, Seroxat): zur Behandlung von Depressionen, Zwangsstörungen, Angststörungen, Sozialphobien und posttraumatischen Belastungsstörungen.
Sertralin (Sertra, Zoloft): Antidepressivum aus der Wirkstoffgruppe der SSRI) zur Behandlung und Prophylaxe von Depressionen, Panik- und Angststörungen sowie posttraumatischen Belastungsstörungen.
Venlafaxin (Venla, Trevilor): stimmungsaufhellendes und antriebssteigerndes Antidepressivum, das bei Depressionen und Angststörungen sowie zur Migräne-Prophylaxe eingesetzt wird.
Andere
Bupropion (Elontril, Zyban, Mysimba, Wellbutrin): Amphetamin, das zur Behandlung von Depressionen, zur Raucherentwöhnung sowie als Anorektikum (Apettitzüngler) eingesetzt wird.
Angstlösende Medikamente (Anxiolytika)
Angstlösende Arzneien werden gegen ständige, anhaltende Ängste verschrieben, z.B. bei einer generalisierten Angststörung.
Buspiron / Buspironhydrochlorid (Busp, Buspon)
Schlafmittel
Doxylamin / Doxylaminsuccinat (Cariban, Gittalun, Hoggar, RapiSom, Sedaplus, Valocordin, Wick MediNait, Xonvea): Beliebter sedierender, zentral dämpfender Wirkstoff bei Schlafstörungen, um das Ein- und Durchschlafen zu erleichtern; auch als Bestandteil in Erkältungsmitteln.
Herz-Kreislauf-Medikamente
Ramipril (Ramiplus, Ramiclair, RamiLich, Appunto, Arelix, Delix, Delmuno, Iltria, Tonotec, Triapin): Blutdrucksenker, ACE-Hemmer bei Bluthochdruck und Herzinsuffizienz sowie zur Vorbeugung von Herzinfarkten.
Quinapril (Accupro, Accuzide, Quinaplus): Blutdrucksenker, ACE-Hemmer bei Bluthochdruck und Herzinsuffizienz.
Enalapril: ACE-Hemmer zur Behandlung von Bluthochdruck sowie zur Vorbeugung und Behandlung von Herzinsuffizienz (Herzschwäche)
Benazepril (Benazeplus, Cibacen, Cibadrex): ACE-Hemmer zur Behandlung von Bluthochdruck Herzinsuffizienz
Valsartan (CoDiovan, Copalia, Cotareg, Dafiro, Diovan, Epiaosan, Entresto, Exforge): Blutdrucksenker zur Behandlung von Bluthochdruck sowie zur Vorbeugung und Behandlung von Herzinsuffizienz (Herzschwäche)
Metoprolol / Metoprololsuccinat (Beloc, Implicor, Jutabloc, Metobeta, Metodura, MetoHexal, Logimat, Logimax, Lopresor, Metohexal, Seloken): Klassischer Betablocker zur Behandlung von Herzschwäche, koronarer Herzkrankheit und zur Migräneprophylaxe
Amlodipin: Blutdrucksenker bei Bluthochdruck
Verapamil (VeraHexal, Isoptin, Tarka): gefäßerweiternder Calciumantagonist zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen, koronarer Herzkrankheit und Bluthochdruck
Felodipin (Delmuno, Felocor, Mobloc, Modip, Logimat, Triapin): Calciumantagonist zur Behandlung von Bluthochdruck
Irbesartan (Aprovel, CoAprovel, Karvea, Karvezide): Blutdrucksenker zur Behandlung von Bluthochdruck und Herzschwäche
Atorvastatin: Cholesterinsenker
Adenosin (Adrekar): bei Herzrhythmusstörungen und zur Blutdrucksenkung
Chinidin (Chinidinum): Antiarrhythmikum zur Behandlung von verschiedenen Herzrhythmusstörungen
Amlodipin: Blutdrucksenker
Ticlopidin (Tiklid, Tiklyd): Blutgerinnungshemmer zur Vorbeugung vor Herzinfarkt und Schlaganfall
Felodipin (Delmuno, Felocor, Mobloc, Modip, Logimat, Triapin): Calciumantagonist zur Behandlung von Bluthochdruck und Angina pectoris.
Lisinopril (Acercomp, Lisi, LisiHexal, Lisiplus): ACE-Hemmer gegen Bluthochdruck und Herzschwäche
Entwässernde Medikamente (Diuretika)
Auch viele Diuretika – insbesondere die sogenannten Schleifendiuretika – wirken potenziell ototoxisch und damit Tinnitus auslösend. Einige können irreversible Hörschäden verursachen.
Diuretika schwemmen Wasseransammlungen (Ödeme) im Körpergewebe aus und werden insbesondere zur Behandlung von Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, Niereninsuffizienz oder Asthma verwendet.
Torasemid (Torem, Toragamma, Unat): Wichtiger Arzneistoff, der Wasseransammlungen (Ödeme) im Körpergewebe ausschwemmt sowie harntreibend und Blutdrucksenkend wirkt.
Amilorid (Amilorektik, Diaphal, Diursan, Moducrin, Tensoflux): Kaliumsparendes Diuretikum, das bei Herzinsuffizienz und arteriellem Bluthochdruck eingesetzt wird.
Bemetizid (Dehydro, Diucomb): Wirkstoff bei Bluthochdruck, Herzinsuffizienz und Wassereinlagerungen
Furosemid (Lasix, Spiro comp., Furo-CT, Furobeta, Furorese): Diuretikum zur Behandlung von Ödemen, Herzinsuffizienz, Asthma und Bluthochdruck.
Acetazolamid (Glaupax, Acemit): Wirkstoff, der vor allem zur Senkung des Augeninnendrucks genutzt wird, insbesondere bei grünem Star (Glaukom)
Bumetanid Burinex, Edemex): Medikament gegen Wasseransammlungen, das auch gegen Autismus und Alzheimer wirken soll
Etacrynsäure: Wirkstoff u.a. bei Herz- oder Niereninsuffizienz, der irreversible Hörschäden verursachen kann
Potenzmittel
Die heute gebräuchlichen chemischen Potenzmittel enthalten als Wirkstoff stets einen sogenannten PDE5-Hemmer. Dieser hemmt ein bestimmtes Enzym, das die Gefäßerweiterung im Penis-Schwellkörper reguliert, kann aber auch Kopfschmerzen, Schwindel und Tinnitus verursachen.
- Sildenafil (Viagra, Kamagra)
- Vardenafil (Levitra)
- Tadalafil (Cialis)
- Avanafil (Stendra, Spedra)
Anti-Malariamittel
- Chloroquin (Resochin): Gängiges Medikament zur Prophylaxe und Therapie von Malaria
- Chinin (Chininum): Natürliches, seit Jahrhunderten verwendetes Malaria-Heilmittel, das heute jedoch kaum noch zu diesem Zweck verwendet wird.
- Mefloquin (Lariam): Früher weitverbreiteter Wirkstoff, der heute wegen teils gravierender neuropsychiatrischer Nebenwirkungen wie Depressionen und Psychosen nur noch in Ausnahmefällen genutzt wird.
Andere Medikamente
- Ribavirin (Rebetol, Copegus): Wirkstoff gegen verschiedene viral bedingte Erkrankungen wie Hepatitic C, Herpes oder Influenza
- Posaconazol: Breitband-Antimykotikum gegen Pilzinfektionen
- Voriconazol (Vfend): Antimykotikum zur Behandllung schwerer Pilzinfektionen
- Amphotericin (Ambisome, Ampho-Moronal, Fungizone): Antimykotikum
- Itraconazol (Sempera, Itraderm, Itraisdin, Siros): Antimykotikum
- Oxybutynin: Arznei gegen häufigen Harndrang und Bettnässen
- Sulfasalazin: Entzündungshemmer zur Behandlung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn
- Timolol (Arutimol, Azarga, Duocopt, Betimol, Chibro-Timoptol, Cosopt, Dispatim, Ganfort, NyoGel, Nyolol Arucom, TimoHexal, Xalacom u.a.): Betablocker, der in Form von Augentropfen bei erhöhten Augeninnendruck und grünem Star (Glaukom) genutzt wird.
- Tacrolismus (Protopic, Envarsus): Immunsuppressivum, eingesetzt bei Autoimmunerkrankungen wie Neurodermitis
- Triptorelin (Decapeptyl, Pamorelin): senkt den Spiegel von Testosteron, Östrogenen und Progesteron; zur Behandlung von Endometriose oder Downregulation in der Reproduktionsmedizin
- Methylergometrin (Methergin): eingesetzt in der Geburtshilfe und zur Migräne-Prophylaxe
- Misoprostol (Angusta, Arthrotec, Cytotec, MisoOne): künstliches Hormon u.a. zur Geburtseinleitung
- Gabapentin (Gabagamma, Neurontin): Antikonvulsivum / Analgetikum zur Behandlung von Epilepsie und Nervenschmerzen
- Gadobensäure (MultiHance): Kontrastmittel zur Bildgebung mit der Magnetresonanztomographie (MRT)
- Loteprednoletabonat (Lotemax, Eysuvis): Corticosteroid, als Augentropfen zur Behandlung von Augenentzündungen
- Alemtuzumab (Lemtrada): Medikament gegen Multiple Sklerose oder Leukämie.
- Lopinavir (Kaletra): Proteaseinhibitor, der zur Behandlung einer HIV-Infektion zum Einsatz kommt.
- Galantamin: Behandlung von Patienten mit leichter bis mittelschwerer Demenz vom Alzheimer-Typ
- Budipin: zur Behandlung der Parkinson-Krankheit
Krebsmedikamente
Auch Chemotherapeutika und andere Medikamente, die in der Krebstherapie eingesetzt werden, können Tinnitus auslösen. Dazu gehören Arzneien, die das Tumorwachstum hemmen oder Nebenwirkungen einer Chemotherapie wie Übelkeit dämpfen. Das Tinnitus-Risiko sollte dabei natürlich kein Grund sein, auf eine lebenswichtige Behandlung zu verzichten!
- Interferon alfa-2b
- Paclitaxel (Abraxane, Apealea, Axitaxel, Bendatax, Pazenir, Taxomedac)
- Buserelin (Profact, Suprefact)
- Temozolomid
- Bortezomib
- Imatinib
- Imiquimod (Aldara)
- Anagrelid
- Aprepitant (Aprepilor, Emend, Ivemend, Fosaprepitant)
- Bexaroten (Targretin)
- Cisplatin
- Bleomycin (Bleo-Cell, Bleomedac)
- Vincristin (Cellcristin)
Quellen
- Side Effect Resource Datenbank, SIDER 4.1: http://sideeffects.embl.de/
- Robert M. DiSogra : Ototoxicity: Tinnitus as a Drug Side Effect. What Healthcare Providers (and Patients) Should Know. In: Tinnitus Today, Summer 2018
- Sharon E. Orrange: Common Medications That Can Cause Tinnitus. In: Tinnitus Today, Summer 2020
- Sharon G. Curhan et. al: Longitudinal Study of Analgesic Use and Risk of Incident Persistent Tinnitus. In: Journal of General Internal Medicine. 7.2. 2022
- Baldo, P., Doree, C., Molin, P., McFerran, D., & Cecco, S.. Antidepressants for patients with tinnitus. Cochrane Database of Systematic Reviews, 12.9.2012
- Langguth, B., Landgrebe, M., Wittmann, M., Kleinjung, T., & Hajak, G.: Persistent tinnitus induced by tricyclic antidepressants. Journal of Psychopharmacology, 13.10.2009
- Gerhard Hesse (2015): Tinnitus. Thieme Verlag
- Inga Leo-Gröning: SOS aus dem Innenohr. In Pharmazeutische Zeitung, 13.11.2006
- Drugs.com, RxList.com, Gelbe-Liste.de
- NetDoktor.de, DocCheck
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, teilen Sie ihn doch mit Ihren Freunden, Bekannten oder Kollegen: